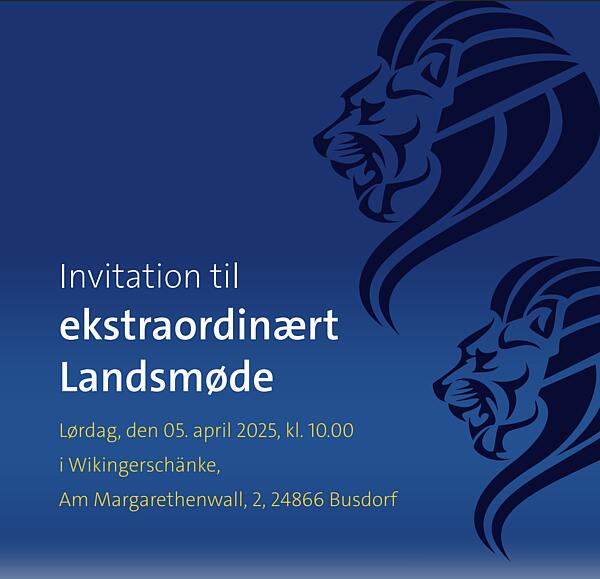Rede · 26.02.2010 Für den Erhalt der solidarischen Kranken- und Pflegeversicherung
Ich möchte vorweg sagen, dass ich sehr viel Verständnis für den vorliegenden Antrag habe. Die Bürgerinnen und Bürger haben sich nur vermeintlich mit den immer neuen Leistungsverschlechterungen bzw. einseitigen Kostensteigerungen im Namen einer so genannten Reform abgefunden; tatsächlich sind die meisten mit dem Ausstieg aus dem Solidarsystem nicht zufrieden. Sie bemerken sehr wohl, wohin die Reise gehen soll: nämlich weiter in Richtung Beitragserhöhung und mehr Zuzahlungen. So kann es nicht weiter gehen.
Der Antrag hat durch die Einsetzung von Arbeitsgruppen, wie vorgestern in Berlin beschlossen, eine ungeahnte Aktualität erlangt, die weit über den Antragstext hinausgeht. Wir müssen uns in der Tat mit der Zukunft der Kranken- und Pflegeversicherung beschäftigen.
Wenn wir diesen Antrag nicht mitgetragen haben, dann liegt es daran, dass bereits der Antragstitel falsch ist. Die solidarische Krankenversicherung gibt es nicht mehr. Die Solidarität wurde und wird schrittweise ausgehöhlt. Spätestens mit den Überweisungsvordrucken für die einseitige Beitragserhöhung, die den meisten gesetzlich Versicherten in den letzten Wochen ins Haus flatterten, war auch noch dem letzten Verteidiger des Solidarprinzips klar, dass es mit der solidarischen Finanzierung nicht mehr weit her ist. Der paritätischen Finanzierung haben einseitige Zuzahlungspflichten der Patienten und die Praxisgebühr den Garaus gemacht. Der Sozialverband Deutschlands sprach vor wenigen Tagen von der einseitige Verlagerung der Gesundheitskosten auf die Versicherten. Die Zusatzbeiträge verstärken darüber hinaus die soziale Schieflage, weil ein Geringverdiener tatsächlich 96 Euro mehr im Jahr berappen muss, während sich ein Großverdiener seine Kosten über die Steuererklärung wieder zurückholen kann.
Da gibt es also wenig zu erhalten. Die Solidarität ist perdu: Chronisch Kranke und Geringverdiener zahlen mehr – und das schon seit Jahren. Der Ausstieg aus der Solidarität durch die privaten Krankenversicherungen ist dabei noch gar nicht berücksichtigt.
Der SSW setzt sich darum für eine Kehrtwende in der Finanzierung der Kranken- und Pflegeversicherung ein. Wir fordern eine Sozialversicherung, die die Lasten gerecht auf alle Schultern verteilt und dabei die Stärkeren stärker belastet und die Schwächeren schwächer. Das ist der einzige Weg. Das ist übrigens auch den Programmen der Antragssteller zu entnehmen. Da heißt das Ganze dann solidarische Bürgerversicherung. Alle Bürgerinnen und Bürger beteiligen sich an der Finanzierung, wobei allerdings alle Einkünfte - also auch Kapitalerträge und Mieteinnahmen - bei der Berechnung berücksichtigt werden.
Anstatt also weiter mit Pflaster am Wasserrohrbruch zu hantieren, sollten wir über eine gründliche Renovierung nachdenken. Das kann keineswegs die Kopfpauschale sein - das ist selbstredend - weil sie die Privatversicherung erhalten will und daneben den Arbeitgeberbeitrag einfrieren will. Das wäre der direkte Weg in ein Zweiklassensystem. Stattdessen müssen wir schleunigst über einen grundlegenden und gerechten Umbau des Sozialstaates nachdenken. Dazu gehört eine steuerfinanzierte soziale Grundsicherung bei der Krankenversorgung, wie sie in den skandinavischen Ländern praktiziert wird. Bei allem Verständnis dafür, dem fortgesetzten Abbau sozialer Leistungen mittels des vorgelegten Antrags ein deutliches Zeichen entgegensetzen zu wollen, kann der Erhalt des derzeitigen Systems zu keiner Zeit im Vordergrund stehen.
Bleiben wir realistisch. Und gerade darum sollten wir über einen grundlegenden Perspektiven-wechsel nicht nur in Papieren fachsimpeln, sondern sie tatsächlich in Angriff nehmen. Wir sollten uns keineswegs mit der zweitbesten der schlechten Lösungen begnügen und weiter herumdoktern, indem wir mit einer Krankenversicherung weitermachen, die einseitig die abhängig Beschäftigten belastet und nicht erst seit der Wirtschaftskrise unter einer massiven Einnahmekrise leidet.
Die solidarische Bürgerversicherung, die steuerfinanziert ohne Umwege direkt den Patientinnen und Patienten zu Gute kommt, ist die bessere Wahl. Diese soziale Absicherung entspricht dem Gedanken der Solidarität tatsächlich, weil sie dem Wortsinn nach solide ist, also zukunftsfest, und sich darüber hinaus auf einer, alle Bürgerinnen und Bürger umfassenden, Gegenseitigkeit gründet.